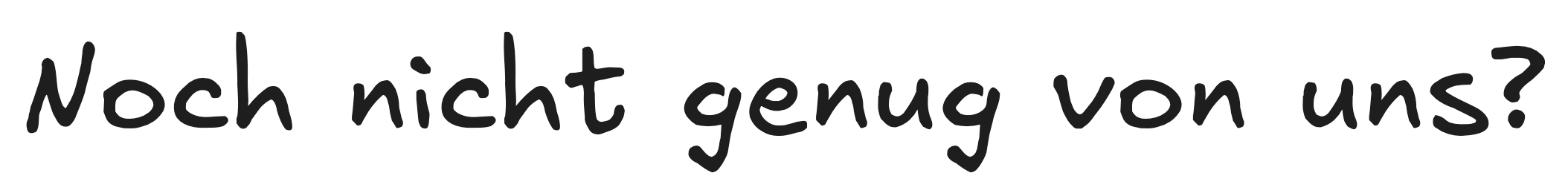Allgemein Arbeitsschutz Schulungen
Flurförderzeuge im Überblick – Unterschiede, Pflichten und Qualifikationen
Flurförderzeuge im Einsatz
Flurförderzeuge sind in nahezu jedem Lager, in der Produktion und in der Logistik unverzichtbare Arbeitsmittel. Der Begriff umfasst jedoch weit mehr als nur Gabelstapler – auch Hubwagen, Mitgängergeräte, Schubmaststapler und Kommissionierer gehören dazu. In der Praxis gibt es häufig Unsicherheiten: Welche Geräte brauchen einen „Staplerschein“? Welche dürfen Beschäftigte nach einer einfachen Unterweisung bedienen? Und welche Anforderungen gelten für spezielle Geräte wie Schmalgangstapler?

Das erwartet Sie in diesem Lexikonartikel
Inhalt
- 1. Was sind Flurförderzeuge?
- 2. Welche Fahrzeuge zählen zu Flurförderzeugen?
- 3. Welche Fahrzeuge gehören nicht zu Flurförderzeugen?
- 4. Worin unterscheidet sich ein Gabelstapler von anderen Flurförderzeugen?
- 5. Welche Vorschriften gelten für Flurförderzeuge?
- 6. Wer darf Flurförderzeuge bedienen?
- 7. Warum gibt es unterschiedliche Qualifikationen?
- 8. Was sind typische Fehler in der Praxis?
- 9. Welche Pflichten hat der Arbeitgeber?
- 10. Fazit
Was sind Flurförderzeuge?
Flurförderzeuge sind bodenbewegte Fahrzeuge, die Lasten innerhalb eines Betriebsgeländes aufnehmen, heben, transportieren oder stapeln. Sie fahren auf flachem Boden („Flur“) und nicht auf Gleisen und werden entweder von einer mitfahrenden Person oder durch Mitgänger geführt. Typische Einsatzbereiche sind Lager, Logistik, Werkstätten, Produktionshallen und Baustellen.
Rechtlich werden Flurförderzeuge in der DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“ definiert. Dazu gehören sowohl einfache Mitgängerhubwagen als auch komplexe, selbstfahrende Stapler. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Lasten bewegen und daher ein erhöhtes Unfallrisiko darstellen, wenn sie nicht sachgerecht betrieben werden.
Zu Flurförderzeugen gehören z. B.:
-
Gabelstapler
-
Schubmaststapler
-
Hochhubwagen
-
Niederhubwagen / Ameisen
-
Mitgänger-Flurförderzeuge
-
Kommissionierer
-
Quersitz- und Seitensitzstapler
-
Schlepper und Routenzüge
Wichtig ist: Nicht jedes Flurförderzeug darf von jedem Mitarbeitenden bedient werden. Je nach Gerät unterscheidet sich die erforderliche Qualifikation deutlich.
Welche Fahrzeuge zählen zu Flurförderzeugen?
Die wichtigsten Kategorien im Überblick:
Mitgänger-Flurförderzeuge (geführt, nicht mitfahrend)
Diese Geräte werden zu Fuß begleitet und über eine Deichsel gelenkt. Sie eignen sich besonders für enge Bereiche und kurze Transportwege.
Beispiele:
-
Handhubwagen
-
Elektrische Niederhubwagen („Ameisen“)
-
Mitgänger-Hochhubwagen
Selbstfahrende Flurförderzeuge (mit Fahrerplatz oder Fahrerstand)
Hier fährt die bedienende Person mit. Diese Geräte sind leistungsfähiger, heben höhere Lasten und werden für intensivere Transport- und Stapelaufgaben genutzt.
Beispiele:
-
Gabelstapler (Gegengewichtsstapler)
-
Schubmaststapler
-
Sitz- oder Standstapler
-
Hochregal- oder Schmalgangstapler
-
Kommissionierstapler
Schlepper und Routenzüge
Fahrzeuge, die als Zugmaschine fungieren und Materialwagen ziehen.
Beispiele:
-
Industrielle Schlepper
-
Routenzugsysteme für produzierende Betriebe
Spezial- und Sonderflurförderzeuge
Geräte für besondere Einsatzbereiche oder erhöhte Anforderungen.
Beispiele:
-
Explosionsgeschützte Flurförderzeuge (EX-Ausführung)
-
Schwerlaststapler für sehr hohe Tragfähigkeiten
-
Schmalgangstapler mit automatischen Assistenzsystemen
Welche Fahrzeuge gehören nicht zu Flurförderzeugen?
Folgende Arbeitsmittel werden häufig verwechselt, zählen aber nicht zu den Flurförderzeugen:
- Krane
- Baumaschinen wie Bagger und Radlader (auch wenn sie Gabeln tragen können)
- Flurförderzeuge zur Personenbeförderung (eigene Regelwerke)
- Hubarbeitsbühnen
- Fahrzeuge für den Straßenverkehr
Kurz gesagt: Flurförderzeuge sind alle innerbetrieblichen Transportfahrzeuge, die auf dem Boden fahren und Lasten bewegen – von einfachen Hubwagen bis zu komplexen Hochregalstaplern.
Worin unterscheidet sich ein Gabelstapler von anderen Flurförderzeugen?
Ein Gabelstapler hebt sich deutlich von anderen Flurförderzeugen ab – sowohl technisch als auch hinsichtlich des Risikos und der Anforderungen an die Bedienung. Die wichtigsten Unterschiede sind:
Bauweise und Leistungsfähigkeit
-
Gabelstapler sind selbstfahrende Fahrzeuge mit Fahrerplatz oder Fahrerstand.
-
Sie verfügen über ein Gegengewicht und können dadurch schwere Lasten sicher bewegen.
-
Sie erreichen höhere Hubhöhen als andere Flurförderzeuge.
Höheres Gefährdungspotenzial
-
Durch Geschwindigkeit, Lastschwerpunkt und Fahrmanöver besteht ein erhöhtes Kipp- und Kollisionsrisiko.
-
Gabelstapler bewegen sich in Bereichen, in denen oft Personen, Waren und Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs sind.
-
Daher sind die gesetzlichen Anforderungen an Betrieb und Bedienung deutlich strenger.
Technische Komplexität
-
Beim Stapler spielen Standsicherheit, Lastschwerpunkt, Fahrphysik und Sichtverhältnisse eine zentrale Rolle.
-
Fehler wirken sich direkt auf die Stabilität aus und können schwere Unfälle verursachen.
Klare Abgrenzung zu Mitgängergeräten
-
Mitgänger-Flurförderzeuge werden zu Fuß begleitet und sind baulich einfacher.
-
Sie haben geringere Fahrgeschwindigkeiten und heben niedrigere Lasten.
-
Das Unfallrisiko ist deutlich geringer, weshalb andere Anforderungen gelten.
Kurz gesagt: Ein Gabelstapler ist das leistungsstärkste, komplexeste und gleichzeitig risikoreichste Flurförderzeug. Genau deshalb unterscheidet er sich deutlich von anderen Geräten und wird rechtlich strenger reguliert.
Welche Vorschriften gelten für Flurförderzeuge?
Der sichere Einsatz von Flurförderzeugen ist in Deutschland klar geregelt. Mehrere Vorschriften greifen ineinander und definieren, wie Geräte betrieben werden dürfen, welche Qualifikation Bediener brauchen und welche Pflichten der Arbeitgeber hat. Die wichtigsten Regelwerke sind:
DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“
Dies ist die zentrale Unfallverhütungsvorschrift.
Sie regelt unter anderem:
-
Anforderungen an Bau und Ausrüstung
-
Betriebsanforderungen
-
Maßnahmen zur Verhütung von Kipp-, Anfahr- und Quetschunfällen
-
Anforderungen an Bedienpersonen
-
Pflichten des Unternehmers (z. B. Prüfung, Wegeführung, Verkehrsregeln im Betrieb)
DGUV Grundsatz 308-001
Dieser Grundsatz beschreibt die Ausbildung und Beauftragung von Gabelstaplerfahrern.
Er legt fest:
-
Inhalte der theoretischen und praktischen Staplerausbildung
-
Prüfungsanforderungen
-
Notwendige praktische Einweisung am Einsatzgerät
-
Schriftliche Fahrerlaubnis durch den Arbeitgeber
DGUV Regel 108-007
Lieferte früher weitere Detailregelungen, wurde jedoch durch aktuelle Vorschriften ersetzt. In vielen Betrieben findet man sie noch als Referenz.
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Regelt den sicheren Betrieb von Arbeitsmitteln, einschließlich Flurförderzeugen.
Sie verlangt:
-
Gefährdungsbeurteilung
-
Festlegung von Prüfintervallen
-
Unterweisung der Beschäftigten
-
Sichere Bereitstellung und Auswahl der Arbeitsmittel
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Grundlage für Unterweisung, Gefährdungsbeurteilung und sichere Arbeitsorganisation.
Straßenverkehrsordnung (StVO) – betriebsintern angewendet
Auch wenn Flurförderzeuge nicht auf öffentlichen Straßen fahren, gelten betriebsintern oft die Grundprinzipien der StVO:
-
Rechtsfahrgebot
-
Schrittgeschwindigkeit
-
Vorrangregelungen
-
Verkehrswegekennzeichnung
Herstellerangaben & Betriebsanleitungen
- Diese sind rechtlich verbindlich und müssen bei Nutzung des Geräts befolgt werden.
Kurz gesagt: Der Betrieb von Flurförderzeugen wird durch ein Zusammenspiel mehrerer Vorschriften geregelt. Kern sind die DGUV Vorschrift 68 und die BetrSichV – ergänzt durch Ausbildungsgrundsätze, Herstellerhinweise und interne Verkehrsregeln. Unternehmen sind verpflichtet, diese Anforderungen umzusetzen.
Wer darf Flurförderzeuge bedienen?
Flurförderzeuge dürfen nur von Personen bedient werden, die dafür fachlich geeignet, unterwiesen, eingewiesen und vom Arbeitgeber ausdrücklich beauftragt wurden. Diese Grundanforderung gilt für alle Geräte – vom einfachen Mitgängergerät bis zum Gabelstapler.
Fachliche Eignung
Die Bedienperson muss körperlich, geistig und fachlich in der Lage sein, das betreffende Gerät sicher zu führen. Dazu gehört ein ausreichendes Reaktionsvermögen, gutes Sehvermögen sowie die Fähigkeit, Lasten und Fahrsituationen richtig einzuschätzen.
Unterweisung und theoretisches Wissen
Für jedes Flurförderzeug ist eine Unterweisung erforderlich. Sie vermittelt die grundlegenden Gefährdungen, Betriebsabläufe und sicherheitsrelevanten Regeln. Diese Unterweisung ist gesetzlich vorgeschrieben und mindestens einmal jährlich zu wiederholen.
Gerätespezifische Einweisung am Einsatzgerät
Jedes Flurförderzeug – selbst identische Modelle verschiedener Hersteller – kann sich unterschiedlich verhalten. Deshalb muss eine konkrete Einweisung durch eine sachkundige Person erfolgen. Diese Einweisung ist zwingend, bevor jemand das Gerät bedienen darf.
Schriftliche Beauftragung durch den Arbeitgeber
Erst wenn der Arbeitgeber ausdrücklich bestätigt, dass eine Person das Gerät bedienen darf, besteht eine gültige Fahrerlaubnis für Flurförderzeuge. Ohne diese Beauftragung darf niemand ein Flurförderzeug führen – unabhängig davon, ob jemand geschult oder erfahren ist.
Besonderer Fall: Gabelstapler und andere selbstfahrende Geräte
Für Gabelstapler und andere selbstfahrende, leistungsstarke Flurförderzeuge gelten erhöhte Anforderungen, da das Unfallrisiko deutlich höher ist. Hier ist eine Ausbildung mit abschließender Prüfung nach DGUV 308-001 erforderlich.
Kurz gesagt: Flurförderzeuge dürfen nur von unterwiesenen, eingewiesenen und schriftlich beauftragten Personen geführt werden. Bei leistungsstärkeren Geräten wie Gabelstaplern kommt eine formale Ausbildung hinzu. Entscheidend ist immer: Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die Bedienperson für das jeweilige Gerät qualifiziert ist.
Warum gibt es unterschiedliche Qualifikationen?
Die unterschiedlichen Qualifikationsstufen bei Flurförderzeugen haben einen einfachen Grund: Nicht jedes Gerät stellt das gleiche Risiko dar. Während ein Handhubwagen vergleichsweise sicher zu bedienen ist, können selbstfahrende Geräte wie Gabelstapler schwere Unfälle verursachen, wenn sie falsch geführt werden.
Die wichtigsten Gründe im Überblick:
Unterschiedliche Gefährdungspotenziale
Ein Mitgängergerät bewegt sich langsam, hat eine begrenzte Hubhöhe und wird zu Fuß begleitet. Das Risiko für schwere Unfälle ist gering. Ein Gabelstapler dagegen fährt mit höherer Geschwindigkeit, trägt große Lasten und kann beim falschen Fahren kippen oder Personen verletzen. Daher braucht er eine umfassendere Qualifikation.
Unterschiedliche technische Komplexität
Moderne Flurförderzeuge unterscheiden sich deutlich in Bedienung, Hydraulik, Fahrmechanik und Schwerpunktverhalten. Ein Schubmaststapler, ein Schmalganggerät oder ein Hochregalstapler erfordern spezielles Wissen, das weit über die Bedienung eines einfachen Hubwagens hinausgeht.
Unterschiedliche Einsatzumgebungen
In engen Gängen, Hochregallagern oder Arbeitsbereichen mit Fußgängerverkehr ist das Risiko höher. Dafür müssen Bedienpersonen besonders gut geschult sein und spezifische Sicherheitsregeln kennen.
Rechtliche Vorgaben
Die DGUV Vorschriften schreiben klar vor, welche Qualifikationen für welche Geräte notwendig sind. Je größer die Risiken, desto höher die erforderliche Ausbildungsstufe.
Verantwortung des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass jede Person nur die Geräte bedient, für die sie qualifiziert ist. Die unterschiedlichen Qualifikationsstufen unterstützen ihn dabei, den Betrieb sicher zu organisieren und Haftungsrisiken zu vermeiden.
Kurz gesagt: Unterschiedliche Geräte bringen unterschiedliche Risiken mit sich. Deshalb brauchen Beschäftigte je nach Gerät ein unterschiedliches Qualifikationsniveau – von der einfachen Unterweisung bis zur umfassenden Staplerausbildung. So wird sichergestellt, dass jedes Flurförderzeug sicher und verantwortungsvoll bedient wird.
Was sind typische Fehler in der Praxis?
Im Umgang mit Flurförderzeugen treten immer wieder ähnliche Fehler auf, die zu Schäden, Störungen oder schweren Unfällen führen können. Viele dieser Fehler entstehen durch fehlendes Bewusstsein, Routinefehler oder unklare Zuständigkeiten. Die wichtigsten Problemfelder im Überblick:
Falsche Annahme: „Ein Gerät ist wie das andere“
Häufig wird angenommen, dass jemand, der einen Gabelstapler fahren kann, automatisch auch mit Schubmast-, Hochhub- oder Mitgängergeräten umgehen kann. In der Realität unterscheiden sich diese Geräte jedoch deutlich in Bedienung, Stabilität und Fahrverhalten.
Bedienung ohne korrekte Einweisung
Ein Staplerschein allein reicht nicht aus. Viele Unfälle passieren, weil Bedienpersonen nicht für das konkrete Gerät oder das spezifische Arbeitsumfeld eingewiesen wurden.
Keine oder unzureichende schriftliche Beauftragung
Unternehmen verlassen sich oft auf „Erfahrung“, statt offizielle Fahrerlaubnisse zu erteilen. Fehlt die Beauftragung, ist der Einsatz rechtlich unzulässig und kann im Schadensfall zu Haftungsproblemen führen.
Falsche oder fehlende Gefährdungsbeurteilung
Oft wird für alle FFZ eine „pauschale“ Gefährdungsbeurteilung erstellt. Dabei unterscheiden sich Risiken zwischen Geräten erheblich – von Kippgefahr bis hin zu Quetschstellen.
Überlastung und fehlerhafte Lastaufnahme
Ein Klassiker: Die Tragfähigkeit wird überschätzt oder die Last falsch aufgenommen. Besonders bei Schubmast- oder Hochregalstaplern führt dies schnell zu Instabilität.
Unklare Verkehrswege im Betrieb
Ohne klare Markierungen, Zonen, Vorfahrtsregeln oder verbotene Bereiche steigt das Risiko von Zusammenstößen zwischen Personen, Staplern und Lagerfahrzeugen.
Fehlende oder verspätete Unterweisungen
Unterweisungen werden oft nur „pro forma“ durchgeführt. Werden Inhalte nicht an Arbeitsmittel und reale Gefährdungen angepasst, verlieren sie ihre Wirkung.
Welche Pflichten hat der Arbeitgeber?
Der Arbeitgeber trägt die vollständige Verantwortung dafür, dass Flurförderzeuge sicher betrieben werden. Diese Verantwortung ergibt sich aus dem Arbeitsschutzgesetz, der Betriebssicherheitsverordnung und der DGUV Vorschrift 68. Entscheidend ist: Sicherheit entsteht nicht durch das Gerät selbst, sondern durch eine fachgerechte Organisation. Die wichtigsten Pflichten sind:
- Geeignete Flurförderzeuge bereitstellen
Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die eingesetzten Geräte für die jeweiligen Aufgaben geeignet sind, regelmäßig geprüft werden und sich in sicherem Zustand befinden. Dazu gehören Sichtkontrollen durch das Bedienpersonal und wiederkehrende Prüfungen durch befähigte Personen.
- Gefährdungsbeurteilung durchführen
Für jedes Gerät und jeden Einsatzbereich muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. Sie legt fest, welche Risiken bestehen und welche Schutzmaßnahmen notwendig sind. Dazu gehört auch die Festlegung der erforderlichen Qualifikation für Bedienpersonen.
- Beschäftigte unterweisen und einweisen
Alle Nutzer müssen vor der ersten Nutzung und danach mindestens jährlich unterwiesen werden. Zusätzlich braucht jede Bedienperson eine gerätespezifische Einweisung. Der Arbeitgeber ist verantwortlich dafür, dass diese Schulungen stattfinden und dokumentiert werden.
- Schriftliche Beauftragung erteilen
Ein Flurförderzeug darf nur von Personen geführt werden, die schriftlich beauftragt wurden. Der Arbeitgeber muss prüfen, ob Qualifikation und Eignung vorliegen, und anschließend eine verbindliche Fahrerlaubnis ausstellen.
- Verkehrswege organisieren und sichern
Der Arbeitgeber muss klare Strukturen schaffen, damit der innerbetriebliche Verkehr sicher abläuft. Dazu gehören markierte Wege, Regeln für Vorfahrt, Bereiche mit Fußgängerverkehr, Tempolimits oder gesicherte Kreuzungsbereiche.
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) bereitstellen
Je nach Gerät und Einsatzbereich müssen geeignete Schutzmittel wie Sicherheitsschuhe, Wetterschutz, Warnkleidung oder Handschuhe bereitgestellt werden.
- Maßnahmen regelmäßig überprüfen
Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass alle Maßnahmen wirksam bleiben – durch Kontrollen, Betriebsbegehungen, Unterweisungen und Prüfungen. Veränderungen in Arbeitsabläufen oder Technik müssen berücksichtigt werden.
Fazit
Flurförderzeuge sind ein zentraler Bestandteil des innerbetrieblichen Materialflusses – vom einfachen Hubwagen bis zum komplexen Schmalgangstapler. Gerade weil die Geräte sehr unterschiedlich aufgebaut sind und ganz unterschiedliche Risiken mit sich bringen, ist es entscheidend, die jeweiligen Anforderungen genau zu kennen. Ein Gabelstapler ist nicht mit einem Mitgängergerät vergleichbar, und nicht jeder Beschäftigte darf automatisch jedes Flurförderzeug bedienen.
Sichere Arbeitsprozesse entstehen durch eine klare Qualifikationsstruktur, regelmäßige Unterweisungen, gerätespezifische Einweisungen und eine vorausschauende Organisation des innerbetrieblichen Verkehrs. Unternehmen, die hier sauber arbeiten, reduzieren nicht nur das Unfallrisiko, sondern vermeiden auch Haftungsprobleme und sorgen für einen reibungslosen, effizienten Materialfluss.
Kurz: Wer Flurförderzeuge zielgerichtet einsetzt und verantwortungsvoll betreibt, schafft Sicherheit, Effizienz und klare Arbeitsabläufe im gesamten Betrieb.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Zu den Flurförderzeugen gehören alle innerbetrieblichen Transportfahrzeuge, die Lasten auf dem Boden aufnehmen, bewegen oder heben. Dazu zählen Gabelstapler, Schubmaststapler, Hochhub- und Niederhubwagen, Mitgängergeräte, Kommissionierer, Routenzüge und spezielle Stapler wie Schmalgang- oder Schwerlaststapler.
Weitere Lexikon-Inhalte